„Nein5xJa“ – was für ein seltsamer Name, oder? Aber dahinter steckt eine herausfordernde Idee: Es ist ein „Nein“, das von gleich fünf „Jas“ getragen wird: Ein Neinsagen, das nicht trennt, sondern verbindet.
Auf meiner Website www.Nein5xJa.de geht es um weit mehr als nur darum, Grenzen zu setzen. Es geht darum, wie ein bewusstes Nein unseren Beziehungen, uns selbst und auch unserem Gegenüber richtig guttun kann. Ich nenne es das „verbindende“ oder sogar das „heilende Nein“.
Dass dieses Thema sogar in Tanz umgesetzt werden kann, zeigt die polnische Künstlerin Monika Gałęska. Schau dir gerne ihr Tanzvideo zum Konzept des heilenden Neins an. Klick zum Tanzvideo von Monika Gałęska (Polen) zum Konzept des Verbindenden Neins, bzw. des Heilenden Neins.
Den tieferen Hintergrund dazu erkläre ich persönlich hier in einem kurzen Video: „Stress-Nein oder heilendes Nein?“ – ein Klick genügt!
Vielleicht kennst du Begriffe wie „Innere Heilung“, „Heilende Worte“ oder „Heilendes Fasten“. Aber hast du schon mal vom „Heilenden Nein“ gehört?
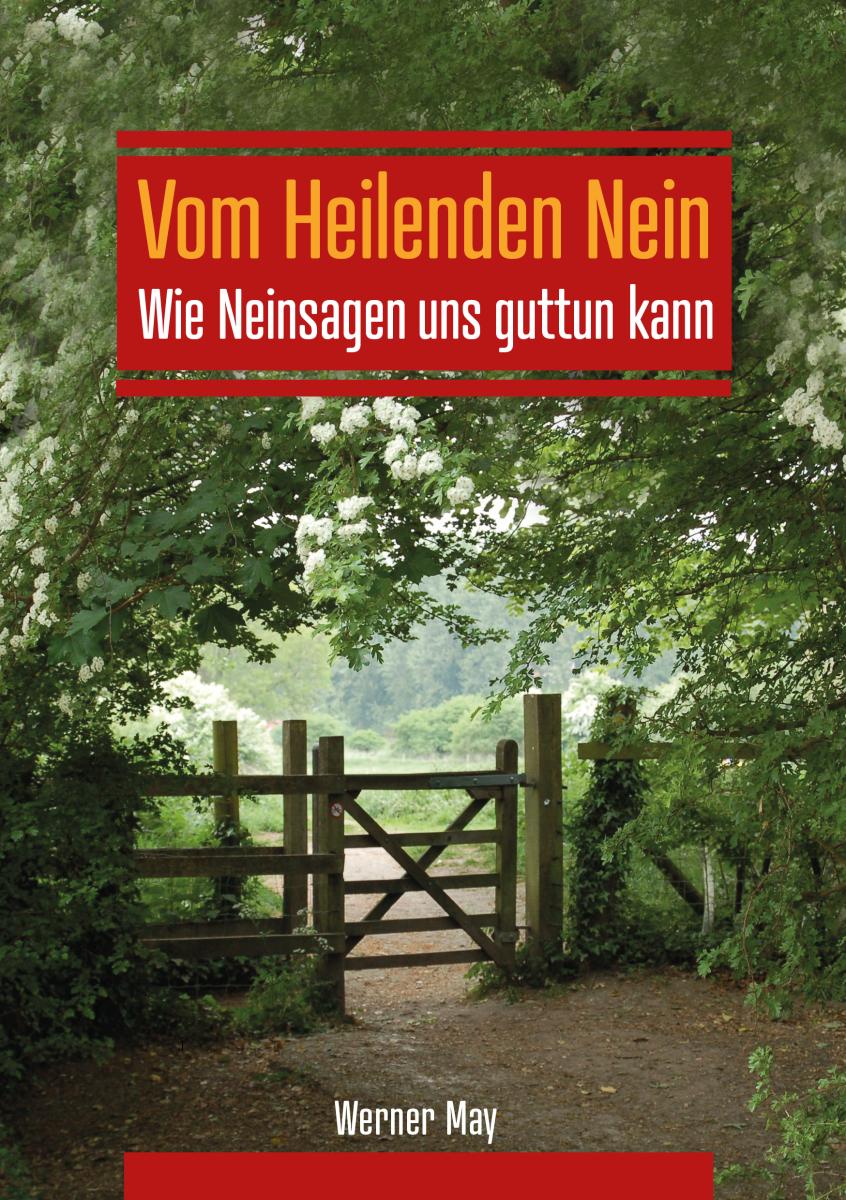 Nach fast 30 Jahren, in denen mich das Thema Nein-Sagen beruflich wie persönlich begleitet hat, habe ich meine Erfahrungen nun in einem weiteren Buch zusammengefasst: „Vom Heilenden Nein. Wie Neinsagen uns guttun kann.“
Nach fast 30 Jahren, in denen mich das Thema Nein-Sagen beruflich wie persönlich begleitet hat, habe ich meine Erfahrungen nun in einem weiteren Buch zusammengefasst: „Vom Heilenden Nein. Wie Neinsagen uns guttun kann.“
Es ist ein Buch für alle: Leicht zu lesen, aber fachlich fundiert - Voll mit lebensverändernden Impulsen - Und es zeigt auf, wie auch ein persönlicher christlicher Glaube dabei eine wertvolle Stütze sein kann.
Das Beste daran: Du kannst dir das ganze Buch kostenlos herunterladen, und zwar hier: Klick > Vom Heilenden Nein. Wie Neinsagen uns gutun kann
Und schaue auch vorbei auf auf Instagramm und auf Facebook. Ich freue mich auf den Austausch mit dir!

